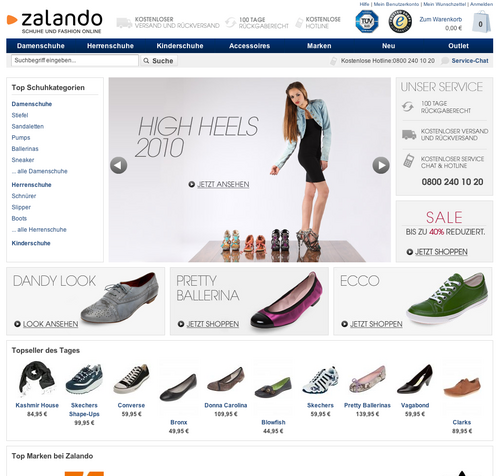Es wird wohl nur wenige Start-ups geben, auf deren Deutschlandstart wir solange warten mussten wie auf Spotify. Das hatte keinen rationalen Grund, sondern lag allein an der völlig absurden rechtlichen und politischen Gemengelage.
Und wie die Faust aufs Auge passt, dass Spotify tatsächlich ohne eine Vereinbarung mit der GEMA gestartet ist, sozusagen auf eigenes Risiko. Gleichzeitig melden die Datenschützer Bedenken an, wegen der Integration mit Facebook.
We’re very excited about our arrival in Germany. You can follow us on @SpotifyDE and stay up to date. #SpotifyDE
— Spotify (@Spotify) March 14, 2012
Alles wie gehabt also? Wahrscheinlich ja. Vermutlich dürfte jener höhere Musikdienst, den wir verehren (Jochen Wegner) früher oder später den deutschen Markt so aufrollen, wie es Amazon (1998), Ebay (1999), Facebook (2008) oder Groupon (2010) vor ihm getan haben. Der einzige Unterschied: Spotify ist kein amerikanisches Start-up, sondern ein europäisches.
Dem deutschen Spotify-Klon simfy gebührt das Verdienst, den hiesigen Markt für das Streaming von Musik reif gemacht zu haben. Doch jetzt sieht sich simfy einem starken Wettbewerber gegenüber, der zudem mit seiner API einen strategischen Vorteil hat. Es bleibt abzuwarten, wie sich simfy dieser Herausforderung stellen wird.
simfy gehört zu den Kunden von SinnerSchrader Mobile.