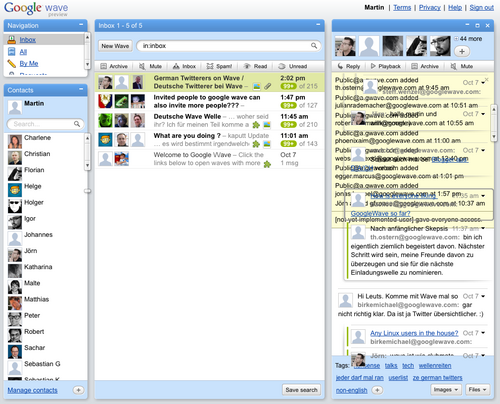Erinnert sich noch jemand an DRM, auch bekannt als Digitale Rechteverwaltung? Wenn es dazu noch etwas zu sagen gibt, dann sagt es Google gleich in den Suchergebnissen:
In der Musikindustrie konnte sich DRM nicht durchsetzen.
Ausgerechnet diesen Satz zitiert Google aus der Wikipedia, und ein paar Fundstellen weiter südlich aus dem englischen Pendant:
In practice, all widely-used DRM systems are eventually defeated or circumvented.
Nuff said. Doch halt, warum gibt es dann immer noch DRM? Warum hat Amazon den Kindle mit digitaler Rechteverwaltung ausgestattet und warum ist das iPhone nicht offen wie Android? Weil Amazon und Apple die Medien- und Unterhaltungsindustrie brauchen, um ihre schönen Geräte mit dem Stoff auszustatten, den die Konsumenten haben wollen. (Beim iPhone ist es die Telekommunikationsbranche, aber das Schema ist das Gleiche.)
So war es mit iPod und iTunes, so ist es mit Kindle und iPhone. Doch irgendwann ist Schluss damit. Als iTunes als Absatzkanal für die Musikindustrie so wichtig geworden war, dass es ohne nicht mehr zu gehen schien, konnte Apple den Stecker ziehen und das DRM abschalten. Das iPhone wird offen sein, wenn und sobald der Erfolg von Android Apple dazu zwingen wird und sich die neuen Machtverhältnisse in der Telekommunikationsbranche gefestigt haben.
Gleiches gilt für den Kindle, wenn und sobald der Druck durch den Nook von Barnes & Noble groß genug. Und wer weiß, was aus dem lange erwarteten Apple Tablet wird? Die New York Times scheint bereits für diese Zukunft zu planen.
Das Muster ist immer das Gleiche: Die Medien- und Unterhaltungsindustrie besteht auf DRM und Bezahlschranken, die Geräteindustrie und der Handel (mit Amazon, Apple und Barnes & Noble in beiden Rollen) spielen das Spiel genau so lange mit, wie sie müssen. Bis ihnen die Text-, Bild- und Tonlieferanten auf den Leim gekrochen sind. Dann ist Schluss mit lustig, also mit DRM.
DRM funktioniert nur für eine Übergangszeit. Es ist ein Placebo mit schmerzlindernder Wirkung für Branchen, deren Geschäftsmodell durch die digitale Revolution bedroht ist. Es macht aber abhängig, und früher oder später stellt der Dealer den Nachschub ein.

![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=6f98e12d-e019-4cd0-b890-d2f3d04f90d5)
![Reblog this post [with Zemanta]](http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=ed0fe8ee-ed6b-4a31-957f-bd90caea38aa)